oder: Warum Schönheit eine Zahl ist
Was macht eigentlich ein Bauwerk für uns harmonisch? Ein Gemälde ausgewogen? Ein Möbelstück angenehm (oder sogar bequem)? Seit Jahrhunderten suchen Künstler:innen, Architekt:innen und Designer:innen nach Regeln, die Schönheit messbar machen. Maß und Proportion sind dabei nie nur technische Werkzeuge, sondern auch Ausdruck dessen, wie Kulturen die/ihre Welt verstehen. Und bei all dem stellt sich ja immer auch die Frage: Wer bestimmt denn eigentlich dieses „rechte“ Maß?
Vom Maß des Menschen zum Maß des Kosmos
Schon in der Antike hat Vitruv versucht, Architektur und ihre Elemente vom menschlichen Körper abzuleiten. Seine berühmte Idee: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. In seinem „De architectura“ beschreibt er, wie Körperproportionen sich in Kreis und Quadrat einfügen und als Symbol für Harmonie zwischen Mensch, Bauwerk und Kosmos stehen. Leonardo da Vinci hat diesen Gedanken dann in seinem berühmten „Vitruvianischen Menschen“ aufgegriffen: eine Figur, die Arme und Beine ausstreckt und sich gleichzeitig in Quadrat und Kreis einfügt (jaja, rund in eckig und so).
Auch der „Goldene Schnitt“ fasziniert seit der Antike. Gemeint ist damit ein Verhältnis von etwa 1:1,618, das viele als besonders harmonisch empfinden. In der Fibonacci-Folge (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …) taucht es immer wieder auf; Rechtecke und Spiralen, die diesem Verhältnis folgen, finden sich in Schneckenhäusern, Sonnenblumen oder sogar in Galaxien!
Architektur greift diesen Gedanken dann wieder auf. Zum Beispiel beim Brandenburger Tor, da entspricht das Verhältnis von Höhe und Breite fast genau dem Goldenen Schnitt. Diese Proportionen sollten aber nicht nur Stabilität sichern, sondern eben auch eine ideale Ordnung sichtbar machen. Wer davor steht, spürt die Balance, ohne die Zahlen dahinter zu kennen (wie denn auch).
Der Goldene Schnitt ist damit mehr als eine Formel. Er ist ein Symbol für dieses uralte Streben, Schönheit und Harmonie messbar zu machen. …und zugleich ein Beispiel dafür, wie sehr sich kulturelle Ideale in Zahlen fassen lassen.
Renaissance: Proportion als sichtbare Ordnung
Die Renaissance griff diese Ideen begeistert auf. Leon Battista Alberti zum Beispiel verbindet Maß und Schönheit: Was gut proportioniert ist, wirkt harmonisch. (Ganz einfach!) Brunelleschis Architektur zeigt klare Raster, die auf einfachen geometrischen Verhältnissen beruhen. Piero della Francesca oder Raffael konstruierten Bildräume, die nach streng berechneten Regeln funktionieren…
Schönheit bedeutete hier Ordnung und Ordnung hieß: die Welt gehorcht Zahlen. Doch gerade in dieser Sicherheit lag dann eben auch eine Einschränkung. Denn: wenn wir das „richtige“ Maß definieren, legen wir auch fest, was „falsch“ ist, was als „unproportioniert“ galt (und gilt!).




Tatami-Matten, Tadao Ando und das Maß im Dialog
In Japan prägt seit Jahrhunderten die Tatami-Matte die Architektur. Tatami sind rechteckige Bodenmatten aus Reisstroh mit einer gewebten Oberfläche aus Binsen. Sie messen etwa 0,90 × 1,80 m – ein Verhältnis von 1:2 – und bilden das Grundmodul traditioneller Häuser. Räume werden nicht in Quadratmetern, sondern in Tatami gezählt: ein Sechs-Matten-Raum, ein Acht-Matten-Raum. Dieses Raster bestimmt nicht nur den Gebäude, sondern auch Alltagsrituale von der Sitzordnung bei Teezeremonien bis zur Platzierung von Möbeln. Maß ist hier zugleich kulturell, sozial und spirituell.
Der Architekt Tadao Ando greift dieses Prinzip in der Moderne auf. Seine strengen Betonbauten folgen dem Tatami-Raster. Auch wenn keine Matten auf dem Boden liegen, bleibt der Maßstab spürbar: in der Struktur und dem Rhythmus der Wände, in den Proportionen der Räume, in der Art, wie sich Bewegung und Blick entfalten. Für Ando ist Maß nicht nur Geometrie, sondern darüber hinaus auch eine Erfahrung: der Schritt, der Atem, das Licht, das durch eine Öffnung fällt.
Ando steht außerdem in der Tradition der westlichen Moderne. Er setzte sich intensiv mit Le Corbusier auseinander, arbeitete zeitweise in dessen Pariser Atelier und studierte seine Ideen. Der Vergleich von beiden ist superinteressant: Während Le Corbusiers Modulor vom idealisierten Körper eines europäischen Mannes ausging und daraus eine universale Norm ableitete, gründet das Tatami-Raster auf einer kulturellen Praxis, die sich über Jahrhunderte in Japan entwickelt hat.
Beide Systeme sind Raster, beide erzeugen Ordnung. Unterscheiden sich aber im Anspruch: Der Modulor wollte ein universales Maß für alle schaffen – mit allen normierenden und ausschließenden Konsequenzen. Das Tatami-System dagegen zeigt, wie Maß auch organisch wachsen kann: aus Ritualen, aus dem Alltag, aus dem konkreten (Zusammen-)Leben.
Ando bringt diese beiden Welten zusammen. Er übernimmt von Le Corbusier die Strenge, das Spiel mit Geometrie und Licht, aber er verankert sie im japanischen Denken, in der Erfahrung von Körper und Raum. So entsteht ein eigener Stil: rational und spirituell zugleich, modern und traditionsbewusst.
Moderne: Norm, Macht und vergessene Urheber
Im 20. Jahrhundert suchte Le Corbusier eben nach einem universalen Maß. Sein Modulor basierte auf dem Körper eines 1,83 m großen Mannes mit erhobenem Arm. Aus dieser Figur entwickelte er eine Maßkette, die Architektur und Möbel bestimmen sollte. Von der Raumhöhe bis zum Türgriff.
Aber: dieser Anspruch war und ist alles andere als neutral. Der Modulor normierte den männlich-europäischen Körper zum Maß aller Dinge. Frauen, Kinder, Menschen mit anderen Körpergrößen oder mit Behinderungen passten schlicht nicht in dieses Raster. Ein Maß, das Allgemeingültigkeit beansprucht, schließt damit eben genau sehr viele aus.
Gleichzeitig entstanden in seinem Atelier in enger Zusammenarbeit mit Charlotte Perriand einige der berühmtesten Möbelentwürfe des 20. Jahrhunderts. Die Chaiselongue B 306, die ikonischen Sessel LC2 und LC3: Perriand hatte an allem maßgeblichen Anteil. Doch veröffentlicht wurden die Entwürfe unter Le Corbusiers Namen. Das war nicht nur Atelierpraxis, sondern spiegelte auch die patriarchale Realität: Frauen konnten seltener Patente anmelden, wurden systematisch übersehen oder kleingeschrieben.
Perriand selbst brachte tatsächlich auch eine andere Haltung mit: Maß sollte nicht normieren, sondern dienen. Ihre Möbel sind flexibel, ergonomisch, anpassbar und berücksichtigen damit den Alltag, die Vielfalt, die Körperlichkeit jenseits des „idealen Mannes“. Erst spät (jetzt vielleicht endlich) kommt die Anerkennung dafür. Ihre Geschichte zeigt, wie eng Norm und Macht miteinander verbunden sind: Wer das Maß bestimmt, bestimmt auch, wer dazugehört. …und eben auch, wer nicht.
Zwischen Raster und Vielfalt
Heute begegnet uns die Frage nach Maß überall: in der Gestaltung von Smartphones, in der Architektur von Städten, in ergonomischen Möbeln. Wir merken aber auch: Ein einziges Maß passt nicht für alle. Diversität, Inklusion und unterschiedliche Lebensformen fordern andere Antworten.
Maß kann dabei gleichzeitig Einschränkung und auch Chance sein. Normen geben Orientierung, erleichtern Planung, schaffen Verbindlichkeit. Aber es liegt eben genau da auch die Gefahr, Vielfalt zu unterdrücken und auszuschließen.
Was wir mitnehmen können
Über Jahrhunderte zeigt sich: Maß und Proportion sind nie unschuldig. Sie sind kulturelle Entscheidungen, die immer auch Machtfragen einschließen. Mal symbolisch und kosmisch, mal rational und normierend, mal menschlich und flexibel.
Vielleicht sollten wir öfters mal Normen hinterfragen, Maße neu definieren, Regeln bewusst nutzen (oder brechen!). Maß ist nicht festgeschrieben. Proportion ist nicht gegeben. Sie ist eine Entscheidung und damit immer auch ein Spiegel von uns und unsere Realität.




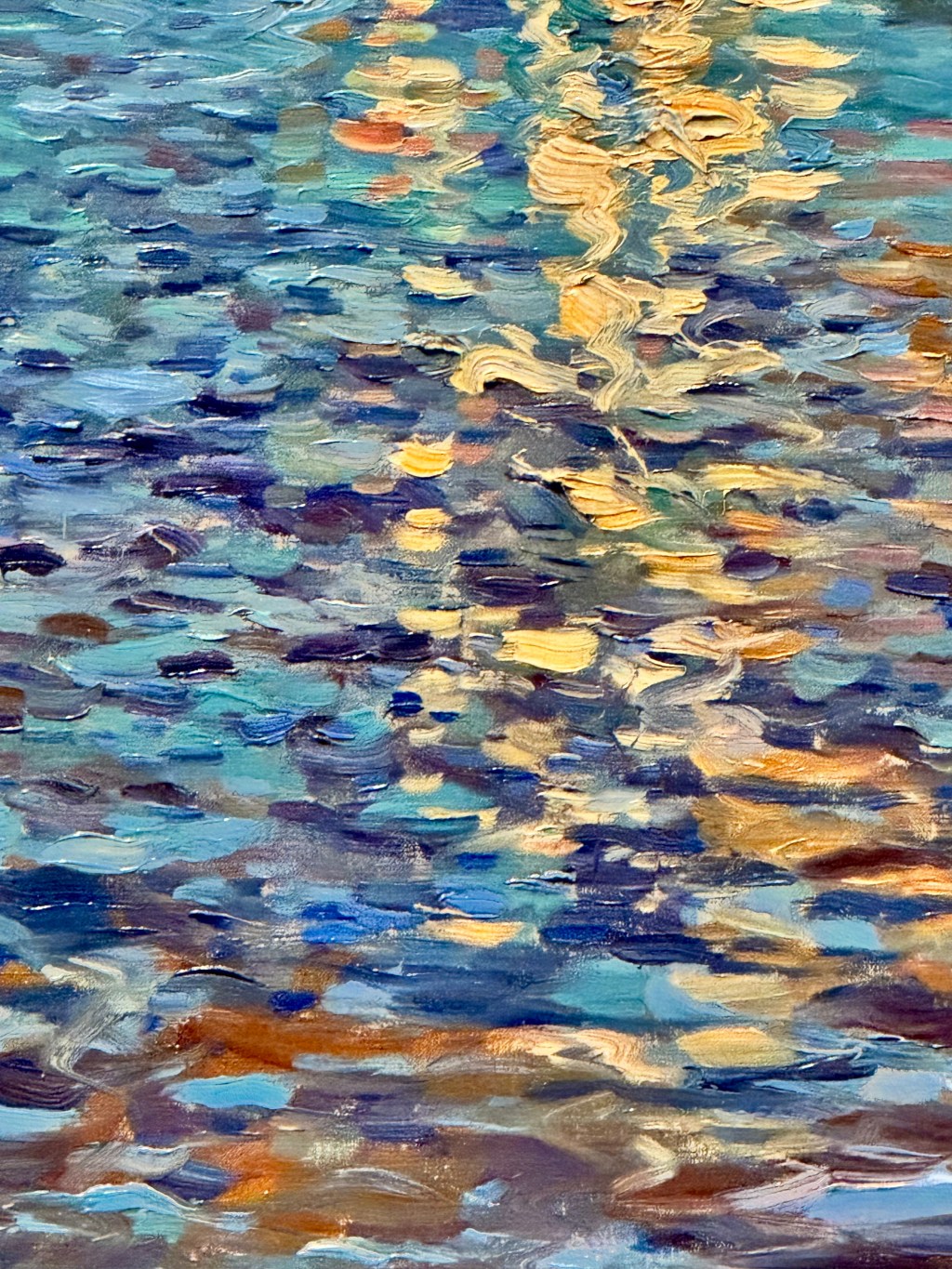



Hinterlasse einen Kommentar