oder: die verborgene Macht, Geschichte zu erzählen
Was ist das eigentlich: Erinnerung?
Ein Geruch, der etwas in uns auslöst? Das Foto von der Geburtstagsfeier vor zehn Jahren?
Oder ist es komplexer? Ist sie ein Gedächtnis der Vergangenheit, eine Sammlung von Geschichten, eine Form des Bewahrens? Und wenn ja: wo bewahren wir? Wo ist dieses Gedächtnis? Bei jeder und jedem von uns?
Oder ist die Erinnerung ein lebendiger Prozess, der ständig in Bewegung ist? …etwas, das wir immer wieder neu erschaffen, wenn wir erzählen, sehen, schreiben, lehren, fragen?
Fest steht: Erinnerung ist nicht einfach das, was bleibt. Sie ist beweglich. Sie ist das, was wir selber am Leben halten. Sie ist persönlich. Und doch ist sie nie nur persönlich. Wir erinnern nämlich individuell und in Gemeinschaften, also in Familien, in Städten, in Sprachen, in Institutionen…
Das, woran sich eine Gesellschaft erinnert, nennt man ihr „kollektives Gedächtnis“. Hört sich gut an, oder? Es hat aber auch ein ABER. Denn so harmlos es klingt, es ist alles andere als neutral. Denn: das kollektive Gedächtnis entscheidet, was (sichtbar) bleibt und was eben auch verschwindet. Krass, oder?
Hinzu kommt: Erinnerung formt unser Weltbild. Sie bestimmt, wie wir die Vergangenheit wahrnehmen, was darin eine Rolle spielt (und was nicht), welche Figuren in ihr vorkommen („Geschichte schreiben“) und welche irgendwo verschwinden. Über Generationen hinweg wurde Geschichte von denen erzählt, die die Möglichkeiten dazu hatten: Zugang zu Bildung, Schrift, Öffentlichkeit. Das waren meist Männer.
In der Antike waren es Gelehrte wie Herodot oder Thukydides, die die ersten großen Geschichtserzählungen geschrieben haben. Und das aus der Perspektive der Krieger und Herrscher, nicht aus der Sicht von den Personen, die irgendwo am Rande von diesen Ereignissen lebten. Warum auch. War ja nicht so spannend (dachte man zumindest). Im Mittelalter verfassten dann Mönche die Chroniken, die das Weltbild ihrer Zeit prägten. Und in der Renaissance (1550) fing dann zum Beispiel der Kunsthistoriker Giorgio Vasari an, über die „großen Meister“ zu schreiben (genauer gesagt hieß es: „Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori“ („Die Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Architekten“). Na ja und damit hat er den Grundstein für einen Kanon festgelegt, in dem fast ausschließlich Männer vorkamen. In seinem Werk stellt er rund 160 Künstlerbiografien zusammen, darunter genau eine Frau: Properzia de‘ Rossi (1490-1530), eine Bildhauerin aus Bologna. …oh, sorry, wir wollen Herrn Vasari nicht unrecht tun: in der erweiterten Ausgabe von 1568 kommt noch Plautilla Nelli (1524-88) hinzu, eine florentinische Malerin und Nonne. Sie taucht aber nur am Rande auf. Ohne eigenes Kapitel… Das heißt also: 99% seiner „großen Künstler“ sind Männer und die Frauen, die vorkommen, erwähnt Vasari nicht als gleichwertige Kollegin, sondern eher als Phänomen. Als große Ausnahme.
Diese Erzählungen wurden über Jahrhunderte weitererzählt, aufgeschrieben, kopiert, gelehrt und ausgestellt. Sie bildeten die Grundlage unseres Geschichtsverständnisses und damit eben auch unserer Wahrnehmung von dem, was als bedeutend gilt. Dass Frauen in diesen Erzählungen kaum vorkommen, führte nicht etwa dazu, dass sie nicht existierten, sondern dass sie nicht erinnert wurden. Ihre Werke, Texte oder Entdeckungen fanden keinen Eingang in Archive, Lehrpläne oder Museen. Und in unser Gedächtnis. In unsere Erinnerung.
Beispiele dafür gibt es noch viiiiiele mehr: Die Malerin Artemisia Gentileschi, zu Lebzeiten sehr berühmt, verschwand nach ihrem Tod nahezu vollständig aus der Kunstgeschichte. Lise Meitner, Mitentdeckerin der Kernspaltung, wurde jahrzehntelang übergangen, während ihr Kollege Otto Hahn den Nobelpreis erhielt. Und Clara Schumann, selbst eine gefeierte Pianistin und Komponistin, wurde in den Musikgeschichten vor allem als „Frau von Robert Schumann“ erwähnt.
Was ich damit sagen möchte: Erinnerung ist ein Prozess. Aber eben kein neutraler. Sie entsteht, wo Macht und die entsprechende Aufmerksamkeit für etwas zusammenkommen. Und sie spiegelt gesellschaftlicher Strukturen, Werte, … und ist genau deshalb formbar, veränderbar. Das, was uns heute als „überlieferte Geschichte“ begegnet, ist immer nur ein Teil, eine Auswahl, die dann im Nachhinein wie eine „Wahrheit“ wirkt. Eine Erzählung, die uns vertraut ist, weil wir sie so oft gehört haben, sie so oft wiederholt, aufgeschrieben und gelehrt wurde. Und die gerade deshalb so unvollständig ist.
Wie Erinnerung funktioniert
Erinnerung ist also selektiv. Sie bewahrt, was wiederholt und weitererzählt wird, und sie vergisst eben genau das, was darin nicht (mehr) vorkommt. Mit der Zeit entstehen daraus Muster, die uns selbstverständlich erscheinen, obwohl sie es nie waren. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs beschrieb dieses Phänomen schon vor hundert Jahren: Menschen erinnern nie isoliert. Wir tun es in Gemeinschaften, und das, was wir erinnern, hängt davon ab, was wir erzählt bekommen.
Hört sich komisch an, aber Geschichte ist tatsächlich (auch wenn wir es oft denken) kein festes Archiv von Fakten, sondern ein Erzählprozess. Und dieser Prozess wiederum ist geprägt von Macht und Perspektive. Über Jahrhunderte entschieden so die Mächtigen (meist Männer) darüber, was bewahrt und was vergessen wurde. Egal, wo. In Chroniken, Lehrbüchern, Kunstsammlungen und Denkmälern… Das Ergebnis ist ein kulturelles Gedächtnis das lauter Lücken hat, Auslassungen, Dinge & Menschen, die fehlen, Namen, Stimmen und Werke, die kaum (oder gar nicht) vorkommen, weil sie nicht in das Bild der Erzählung passten.
Und so prägt diese „sichtbare Abwesenheit“ unsere Wahrnehmung bis heute. Das Unsichtbare ist überall sichtbar: in Schulbüchern, Straßennamen, Museumssälen. Und sie formt (und wir merken es oft nicht mal) unsere Vorstellung davon, wer Geschichte schreibt und wer eben nur eine Randerscheinung ist.
Museen als Speicher der Erinnerung
An einem Ort wird dieses Prinzip vielleicht besonders deutlich. In Museen. Sie gelten als Speicher unseres kulturellen Gedächtnisses, als Raum, in dem eine Gesellschaft zeigt, was sie gerne aufheben möchte. Aber Museen erzählen eben auch nie die ganze Geschichte. (Gut, das wird räumlich schon schwierig.) Aber sie zeigen (logischerweise) das, was gesammelt wurde. Und gesammelt wurde vor allem das, was in die Normen und Ideen der jeweiligen Zeit passte.
Wer heute durch die großen (und kleinen) Museen geht, sieht, wie einseitig diese Erinnerung sein kann: In den meisten Sammlungen stammen mehr als neunzig Prozent der Werke von Männern. Künstlerinnen gab es in allen Epochen, doch sie wurden selten gesammelt, selten dokumentiert, selten gezeigt. Wo nichts im Depot liegt, kann auch nichts ausgestellt werden und was nicht gezeigt wird, verschwindet irgendwann aus dem Bewusstsein. (Oder, wie wir gerade aktuell immer wieder in den Medien mitbekommen: wird von Menschen in Machtpositionen, die meinen, darüber entscheiden zu können, aktiv aus diesem Bewusstsein entfernt.)
Erst in den letzten Jahrzehnten beginnen Museen, diese Mechanismen tatsächlich auch offen zu legen. Provenienzforschung, Gender Studies, postkoloniale Perspektiven, alles Begriffe, die „plötzlich“ auftauchen und die alle Fragen an das Gedächtnis der Institution stellen. Wer wurde gesammelt, wer nicht? Welche Erzählungen sind entstanden, weil andere fehlten? Erinnerungskultur ist da dann nicht (nur) konservierend, sondern (auch) korrigierend. Ein lebendiger Prozess, der das Bild der Vergangenheit ständig überprüft.
Wahrnehmung und Erinnerung
Erinnern fängt aber schon vorher an. Nämlich mit Wahrnehmen. Wir sehen ja schon nie neutral, sondern immer durch (unseren individuellen) Filter aus Erfahrung, Bildung und sozialer Prägung. Was in unseren Blick gerät, hängt davon ab, was wir erwarten. Wenn wir in einem Museum auf bekannte Namen stoßen, nehmen wir das oft als Bestätigung: Da hängen die Meisterwerke, da, wo sie hingehören. Aber wenn wir uns fragen, wer fehlt, dann verändert sich der Blick.
Plötzlich erzählen die Lücken selbst Geschichten. Sie zeigen, dass Geschichte nicht vollständig ist, sondern gestaltet. Und genau da entsteht Bewusstsein dafür, dass Erinnerung nicht einfach überliefert, sondern gemacht wird. Durch Auswahl, Sprache und schlussendlich Deutung. Wahrnehmung ist ein Teil vom Prozess. Sie entscheidet mit, was gesehen, was erinnert, was bewahrt wird. Was Geschichte wird.
Frauen in der Geschichte – Erinnerung in Bewegung
Nochmal ein Blick auf die Rolle von Frauen in der Geschichtsschreibung, weil es hier besonders deutlich wird. Die Herrscherinnen, Forscherinnen, Künstlerinnen und Erfinderinnen der Geschichte waren (wie schon gesagt) immer da. …nur eben kaum sichtbar. Fatima al-Fihri gründete im 9. Jahrhundert in Fès die älteste noch bestehende Universität der Welt. Hypatia von Alexandria lehrte Mathematik und Astronomie, Ada Lovelace entwarf das erste Computerprogramm, Hedy Lamarr entwickelte das Prinzip, auf dem später WLAN beruhte. Und trotzdem sind ihre Namen für viele bis heute wenig bekannt oder unbekannt.
Diese Unsichtbarkeit hat nichts mit Bedeutungslosigkeit zu tun, sondern – man ahnt es vielleicht schon – mit Erinnerung. Jahrhunderte lang wurden Leistungen von Frauen kleiner gemacht als sie waren, übersehen oder schlicht jemand anderem zugeschrieben (oh ja, ganz schön oft sogar). Das kollektive Gedächtnis sortierte sie also aus und formte so ein Bild von Geschichte, in dem die Macht männlich, die Kreativität männlich, das Denken männlich war.
Aber (good news!) Erinnerung lässt sich verändern! Heute holen Museen, Archive und Forschungsprojekte diese vergessenen Biografien zurück ins Licht. Sie zeigen, dass Geschichte eben kein starres Gefüge ist, sondern ein bewegliches Netzwerk aus Perspektiven. Indem wir diese Frauen wieder sichtbar machen, verändern wir nicht nur die Vergangenheit, sondern auch unser Bild von der Gegenwart. Erinnerungskultur ist also mehr als passives Bewahren, sie ist aktive Gestaltung.
Das kollektive Gedächtnis als Machtstruktur
Nochmal zurück zu Maurice Halbwachs und seinem Begriff des kollektiven Gedächtnisses. Halbwachs stellte also fest, dass Erinnerung immer in sozialen Zusammenhängen entsteht, Menschen sich also immer in Gruppen erinnern: in Familien, in Generationen, in Nationen oder Institutionen. Erinnerungen, so seine These, sind keine rein individuellen Bilder, sondern soziale Konstruktionen, die sich an gemeinsame Werte, Erzählungen und Symbole binden.
Das kollektive Gedächtnis ist also kein Archiv im wörtlichen Sinn. Es besteht nicht aus Aktenordnern oder Daten, sondern aus geteilten Geschichten, Ritualen und Bildern (die dann auch Identität stiften). Es bildet den Rahmen, in dem wir unsere eigene Vergangenheit deuten und damit auch die Grundlage, wie wir Entscheidungen für die Zukunft treffen und handeln.
Jede Gesellschaft besitzt so ein Gedächtnis, in dem sie mit Festen, Denkmälern, Feiertagen, Unterricht, Kunst, Medien, ach, allem möglichen, immer wieder neu festgelegt, was als „erinnerungswürdig“ gilt.
Wenn man dann genau hinschaut, sieht man: Dieses Gedächtnis ist kein Speicher, der einfach wächst, sondern ein System, das auswählt. Es sagt uns, was wir für wichtig halten, und prägt, wie wir uns selbst verstehen. Und wenn ich mich für das eine entscheide, entscheide ich eben auch immer gegen etwas anderes. Ist so. Also: Auswahl ist immer auch Ausschluss und damit Erinnerung immer ein Akt der Macht. Fakt.
Lange Zeit wurde diese Macht kaum hinterfragt. Sie lag in den Händen von denen, die Zugang zu Bildung, Öffentlichkeit und Ressourcen hatte. Und das waren nicht so viele. Deshalb ist das, was wir heute für „unsere Geschichte“ halten, nur ein Ausschnitt, gefiltert durch Jahrhunderte männlicher, westlicher Perspektiven. Aber (wie oben schon mal gesagt) Erinnerung ist kein abgeschlossenes Buch, sondern lässt sich neu lesen, neu schreiben, neu erzählen.
Genau das passiert im Moment an vielen Stellen. Museen beginnen, ihre Sammlungen kritisch zu betrachten, Denkmäler werden ergänzt, historische Narrative werden überprüft. Neue Forschung entdeckt Netzwerke, in denen Frauen, Künstler:innen und Aktivist:innen ihre Spuren hinterlassen haben. Wo? Na ja, eben genau an den Stellen, die bislang niemand (genau) angeschaut hat. Und digitale Archive, Podcasts oder Projekte in sozialen Medien machen diese Geschichten (leichter) zugänglich, sie teilen sie weiter und verankern sie im öffentlichen Bewusstsein.
So verändert sich dann auch das, was sichtbar ist. Erinnerung öffnet sich. Das ist ein laaaaaaangsamer Prozess. Aber immerhin es tut sich was. Und damit verschiebt sich dann auch unser Verständnis von Geschichte: weg von einer Abfolge großer Namen und Daten, hin zu einem dichten Gewebe aus Stimmen, Erfahrungen und Perspektiven. Superspannend! Was bringen uns all die abstrakten Jahreszahlen, wenn wir sie nicht in Beziehungen zueinander setzen können, wenn sie keine Geschichte(n) erzählen?!
Erinnerung als Haltung
Zum Schluss nochmal der Versuch, das ein bisschen zusammenzufassen: Erinnerung ist also nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man (im besten Fall kontinuierlich) pflegt. Das braucht Aufmerksamkeit, Interesse, Neugier. Erinnerung ist kein Rückblick, sondern eine Haltung (zur Gegenwart).
Das bedeutet: Fragen stellen, Zusammenhänge sehen und zeigen, Leerstellen bewusst zu machen. Erinnerung passiert im Miteinander, in Gesprächen, in Ausstellungen, in Texten und eben auch in den Momenten, in denen wir etwas Neues erkennen.
Wenn wir Geschichte(n) erzählen, gestalten wir Erinnerung mit. Jede Perspektive, die wir hinzufügen, verändert das Ganze. Und manchmal reicht schon ein kleiner Perspektivwechsel, um zu verstehen, dass das, was wir für selbstverständlich halten, nur eine von vielen möglichen Erzählungen ist. Oh ja, ich habe das Gefühl, da ist noch viel mehr Hinhören nötig, denn nicht nur im Erzählen, sondern (wahrscheinlich sogar noch mehr) im Zuhören entwickeln sich Perspektiven, Geschichten und damit eben Erinnerung.
Vielleicht liegt genau da auch die eigentliche Macht der Erinnerung: Sie zwingt uns quasi, uns selbst zu befragen. Und sie lädt dazu ein, zuzuhören, hinzusehen und anzuerkennen, dass Geschichte eben kein abgeschlossener Raum ist, sondern ein beweglicher.
Und vielleicht fängt genau da eine „Kultur der Erinnerung“ an: nicht bei diesen großen Gedenkveranstaltungen, sondern in den vielen kleinen Momenten im Alltag. Immer dann, wenn jemand fragt, wer oder was fehlt. Oh, und natürlich im Staunen! Und neugierig sei. Und im Erzählen. Und: Erinnerung passiert im Miteinander!




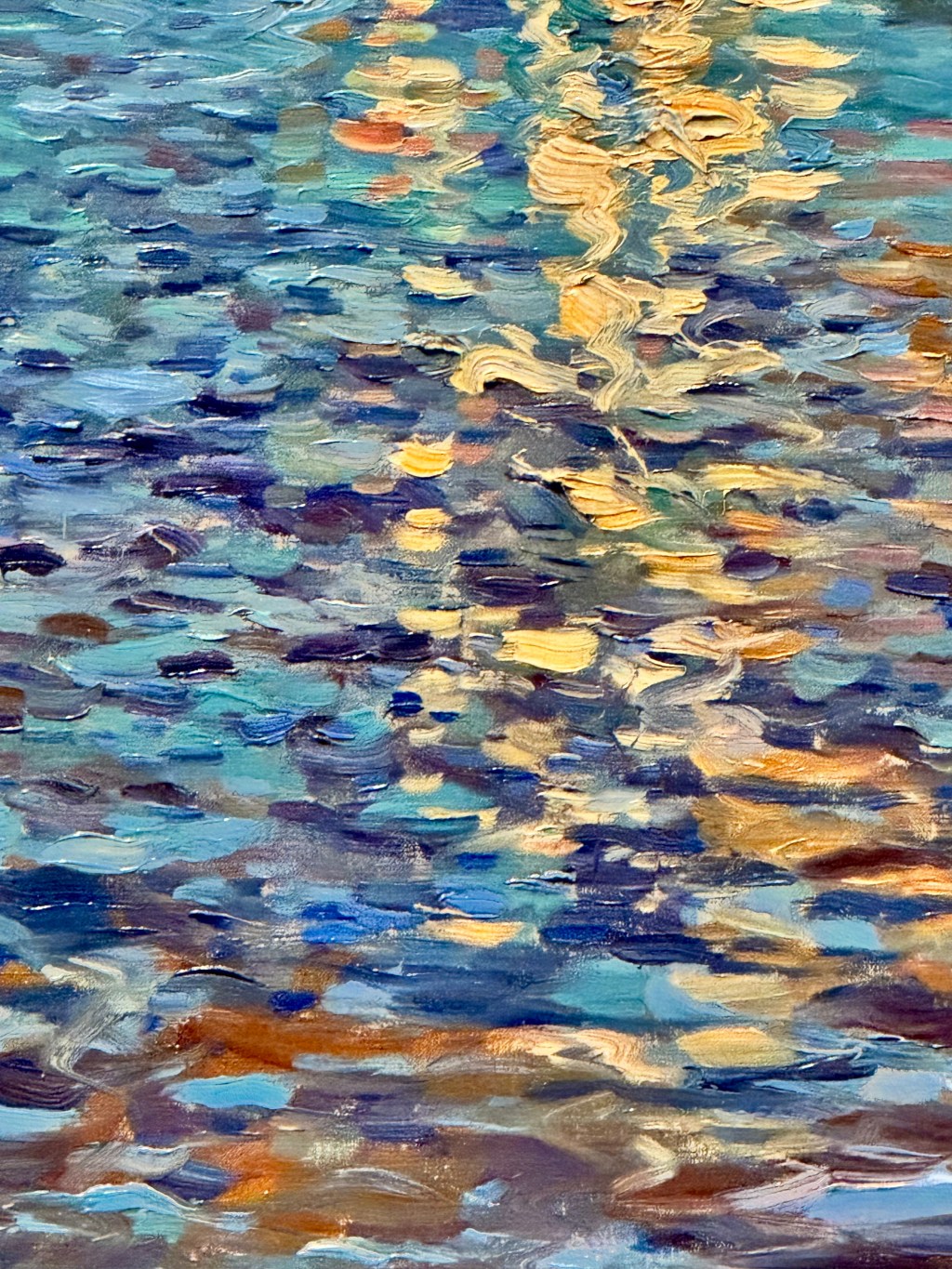



Hinterlasse eine Antwort zu dreamily94ef67acfd Antwort abbrechen