Was macht Architektur mit uns?
Architektur ist ja so was, das begleitet uns und wir bemerken es fast nicht mehr. So ein Alltagsding eben. Einfach da. Ohne dass wir es ständig bemerken. Architektur bildet aber eben den Rahmen für unser Leben, sie ordnet den Raum, in dem wir uns bewegen, und beeinflusst, wie wir denken, fühlen und handeln. Ein Platz kann uns offen begegnen oder einschüchtern, eine Fassade kann Vertrauen schaffen oder Distanz erzeugen. Manchmal spüren wir das sofort und manchmal eben erst, wenn wir uns fragen, warum uns ein Ort auf seltsame Weise beeindruckt oder vielleicht sogar beunruhigt. Architektur ist keine Kulisse, keine Bühne, sie ist Mitspielerin. Und wer baut, formt damit logischerweise auch immer eine Vorstellung davon, was wichtig ist. …und wer was zu sagen hat…
So war es schon in der Antike: Bauen wird zur Sprache der Macht. Die Pyramiden von Gizeh beispielsweise sind mehr als Gräber: Sie sind steingewordene Weltbilder. Ihre Form steigt in den Himmel auf, ihr Material verspricht Ewigkeit. In ihnen manifestiert sich die Vorstellung, dass Herrschaft göttlich sei und Dauer und Bestand die höchste Tugend (wenn die Erbauer gewusst hätten, wiiiiiiiieeee lange ihre Pyramiden stehen!). Wer vor diesen Bauwerken steht, spürt regelrecht, dass da irgendwie was Übermenschliches drin steckt und sie geben uns natürlich auch viele Rätsel auf: Wie hat man eigentlich die Steine nach ganz oben gebracht? Und wie ist das Material dahingekommen? Und und und…
Ein paar Jahrhunderte später, in Griechenland, verändert sich diese Sprache. Hier sucht Architektur nicht mehr nach göttlicher Unantastbarkeit, sondern nach menschlicher Ordnung. Der Parthenon auf der Akropolis von Athen zum Beispiel ist quasi ein Manifest dieses Denkens: jede Säule leicht nach innen geneigt, jede Proportion berechnet, alles im Gleichgewicht. Schönheit und Vernunft sollen sich gegenseitig bestätigen. Macht wird rationalisiert, sie soll überzeugen, nicht erdrücken.
Aber auch in dieser harmonischen Welt ist Hierarchie in Stein gemeißelt und damit fest verankert. Die drei klassischen Säulenordnungen, die wir heute als dorisch, ionisch und korinthisch kennen (wer sich die Reihenfolge nicht merken kann, hier ist eine kleine Eselsbrücke: Einfach die Anfangsbuchstaben nehmen und zusammensetzen, dann entsteht „dik“, das ist die Reihenfolge, die diese Buchstaben auch im Alphabet haben und es ergibt – mit ein bisschen Fantasie – das Wort „dick“). Jedenfalls sind das nicht einfach Stilvarianten. Sondern sie bilden eine gesellschaftliche Grammatik. Die dorische Säule, kräftig, schmucklos und ohne Basis, gilt als Ausdruck von Disziplin und Stärke, sie passt zu Ordnung und Gesetz, ist wie eine Grundlage für alles. Die ionische Ordnung, eleganter und mit Voluten (das sind diese Widderhörner) verziert, spricht von Bildung, Geist und Maß. Und die korinthische Ordnung, mit ihren reich dekorierten Akanthusblättern, ist die Sprache des Glanzes, des Reichtums, der Raffinesse. (Akanthus kennt man übrigens auch als Bärenklau.) In dieser Abfolge spiegelt sich eine soziale Ordnung: von der Klarheit der Tugend bis zur Pracht der Macht. Hier bleibt also die Architektur ein System von Rang und Bedeutung.
Rom übernimmt dieses Vokabular (wie so vieles) und dehnt es aus. Macht wird hier zur Inszenierung, aber öffentlicher, politischer, technischer. Das Pantheon, mit seiner riesigen Kuppel und dem runden Lichtauge, ist weniger Tempel als vielmehr ein Weltmodell. Das Sonnenlicht wandert über die Wände wie ein göttlicher Zeiger, während der Raum das Universum nachbildet. Der Kaiser steht buchstäblich im Zentrum. Architektur wird zum Medium des Staates, zur Inszenierung der Idee, dass Ordnung von oben kommt.
Im Mittelalter richtet sich der Blick dann wieder nach oben, diesmal zu (nur noch) einem Gott. Die Kathedralen der Gotik wie in Chartres oder Köln wachsen über die Städte hinaus, sie scheinen die Schwerkraft zu überwinden. Die Architektur selbst wird zum Gebet. Ihre Pfeiler streben nach oben, ihre Fenster durchfluten den Raum mit dem farbigem Licht der Buntglasfenster. Man betritt diese Kirchenräume in der Regel aus dem dunklen Westen und geht der Erleuchtung, dem Licht, Gottes Wort, entgegen. Der Chor im Osten mit dem Altar ist das Ziel. Unwissend, klein betritt der Mensch die Kirche im tatsächlichen wie im übertragenen Sinn: denn auch das kirchliche Leben beginnt mit der Taufe, das Taufbecken steht häufig direkt neben dem Eingang. Weiter geht es dem Altar entgegen und durch das kirchliche Leben – bis wir dies schließlich abgeschlossen haben und in einem Zwischenraum zwischen menschlichem Leben und dem, was danach kommt landen. Irgendwo hinter dem Altar, im Chorraum. In dem Bereich, der sonst nur den Geistlichen vorbehalten ist. Weil sie schon zu Lebzeiten diese Verbindung „nach oben“ haben… (Kleiner Hinweis: in fremden (europäischen) Städten kann man sich durch die Ostung der Kirchen sehr gut orientieren: In der Regel (Ausnahmen bestätigen die Regel), befindet sich der Eingang einer Kirche immer im Westen und der Chor im Osten. Falls also Google Maps mal versagt: here you go!)
So, als sich dann mit der Renaissance das Denken wieder massiv verändert, wandert der Mittelpunkt erneut: von Gott zum Menschen. Die Antike und der antike Humanismus wird wiederentdeckt, ihre Proportionen, ihre Logik, ihr Vertrauen in Maß und Zahl. Der Mensch ist selbst ein (der?) Maßstab der Welt, schön verkörpert in da Vincis „Vitruvianischem Menschen“.
Filippo Brunelleschi konstruiert zu dieser in Florenz die gewaltige Kuppel des Doms. Technisch absolut gewagt und visionär. Sie spannt den Himmel über eine Stadt, die an Vernunft glaubt. Donato Bramante baut den kleinen „Tempietto“ in Rom: ein perfekter Kreis aus Säulen, jede Linie in Beziehung zur anderen. Architektur wird hier zum Ausdruck einer humanistischen Weltsicht. Schön, weil sie geordnet ist; geordnet, weil sie dem Denken folgt.
Aber kaum ein Jahrhundert später verwandelt sich dieses Vertrauen dann wieder in eine Bühne der Inszenierung. Im Barock geht es nicht mehr um Maß, sondern um Wirkung, um Show, um Repräsentation! Versailles ist kein Schloss, es ist ein System. Achsen, Spiegel, Gärten, … alles ordnet sich um einen Mittelpunkt: den König. Wer durch diesen Raum schreitet, bewegt sich in einer Choreografie der Macht, vom Aufstehen, bis zum Schlafengehen. Auch Berninis Petersplatz in Rom funktioniert so: die Kolonnaden, die sich wie Arme öffnen, sind zugleich Umarmung und Umklammerung. Architektur wird zum Theater, der Raum eine Inszenierung.
Das 19. Jahrhundert schließlich bringt eine neue Form der Macht hervor: die des Fortschritts und der Technik. Die Industrialisierung verändert nicht nur die Städte, sondern auch die Materialien. Eisen, Stahl und Glas erlauben Spannweiten, von denen frühere Generationen nur träumen konnten (ok, Beton hatten die Römer auch schon, sie nannten ihn „opus caementitium“ und nutzten diesen Baustoff, der sich aus gebranntem Kalk, vulkanischer Asche (Puzzolanerde), Sand und Wasser zusammensetzte, für monumentale Bauwerke wie das Pantheon und Aquädukte. Der römische Beton zeichnete sich durch seine extreme Haltbarkeit aus, die auf chemischen Reaktionen und der Verwendung von Kalk in seiner reaktiven Form beruhte, was ihn unter Wasser sogar noch fester machte. Cool, oder?).
Der Crystal Palace in London, errichtet von Joseph Paxton 1851 für die erste Weltausstellung, ist hier ein Meilenstein. Eine Kathedrale aus Glas, in der die Industrie sich selbst feiert. Wenige Jahrzehnte später ragt der Eiffelturm über Paris, ein technisches Wunderwerk, das ursprünglich als Provisorium gedacht war und sehr unbeliebt war und dann zum Symbol einer ganzen Epoche wurde. Bahnhöfe sind die neuen Tempel: Orte, an denen Bewegung, Handel und Zeit zu Göttern werden. Macht zeigt sich nun nicht mehr im Besitz, sondern im Fortschritt.
Die Moderne des 20. Jahrhunderts versucht, aus diesem Rausch der Größe eine Ethik zu entwickeln. Die Architektur soll ehrlich sein, vernünftig, menschenzentriert. Das Bauhaus-Gebäude in Dessau, die Villa Savoye von Le Corbusier oder Mies van der Rohes Glasbauten verkörpern diese neue Sachlichkeit. Transparenz, Klarheit, Logik, eine Ästhetik des Vertrauens.
Doch dieselben Formen können auch anders gelesen werden. Albert Speer nutzt Monumentalität, Mussolini den Rationalismus, Stalin die Kuppel. Macht erkennt die Wirkung des Raumes und benutzt sie bzw. missbraucht sie für ihre Zwecke.
Nach 1945 sucht Architektur dann nach einem neuen Tonfall. Glas wird zum Symbol demokratischer Offenheit. Das UN-Hauptquartier in New York zeigt, dass Macht sichtbar und überprüfbar, transparent sein kann. Später setzt Sir Norman Foster dem Berliner Reichstag eine gläserne Kuppel auf, ein architektonisches Bekenntnis zur Transparenz. Die Bürger:innen sollen buchstäblich von oben in die Regierung blicken können.
Heute hat Macht ihre Form nicht verloren, aber die Geografie hat sich verändert. Die höchsten Türme stehen in Dubai, Shanghai oder Kuala Lumpur. Der Wolkenkratzer ist die moderne Säule: dieselbe Geste wie einst, nur höher, schlanker, glänzender. Auch in der Glasfassade lebt die alte Symbolik weiter: Licht als Zeichen des Fortschritts, Transparenz als Versprechen. Nur die Auftraggeber haben gewechselt: Statt Pharaonen oder Fürsten bauen nun Konzerne, Staatenbünde, Marken.
Architektur bleibt ein Spiegel der Gesellschaft, die sie hervorbringt. Sie zeigt, woran wir glauben, was wir bewahren wollen und was wir verdrängen. Sie spricht in Formen, Achsen, Materialien. …manchmal laut, manchmal leise, aber immer mit Absicht.
Vielleicht lohnt es sich, beim nächsten Spaziergang einmal genauer hinzusehen:
Wie will dieses Gebäude gesehen werden? Will es beeindrucken, beschützen, öffnen oder überhöhen? Und was erzählt es über uns, die darin leben oder arbeiten?




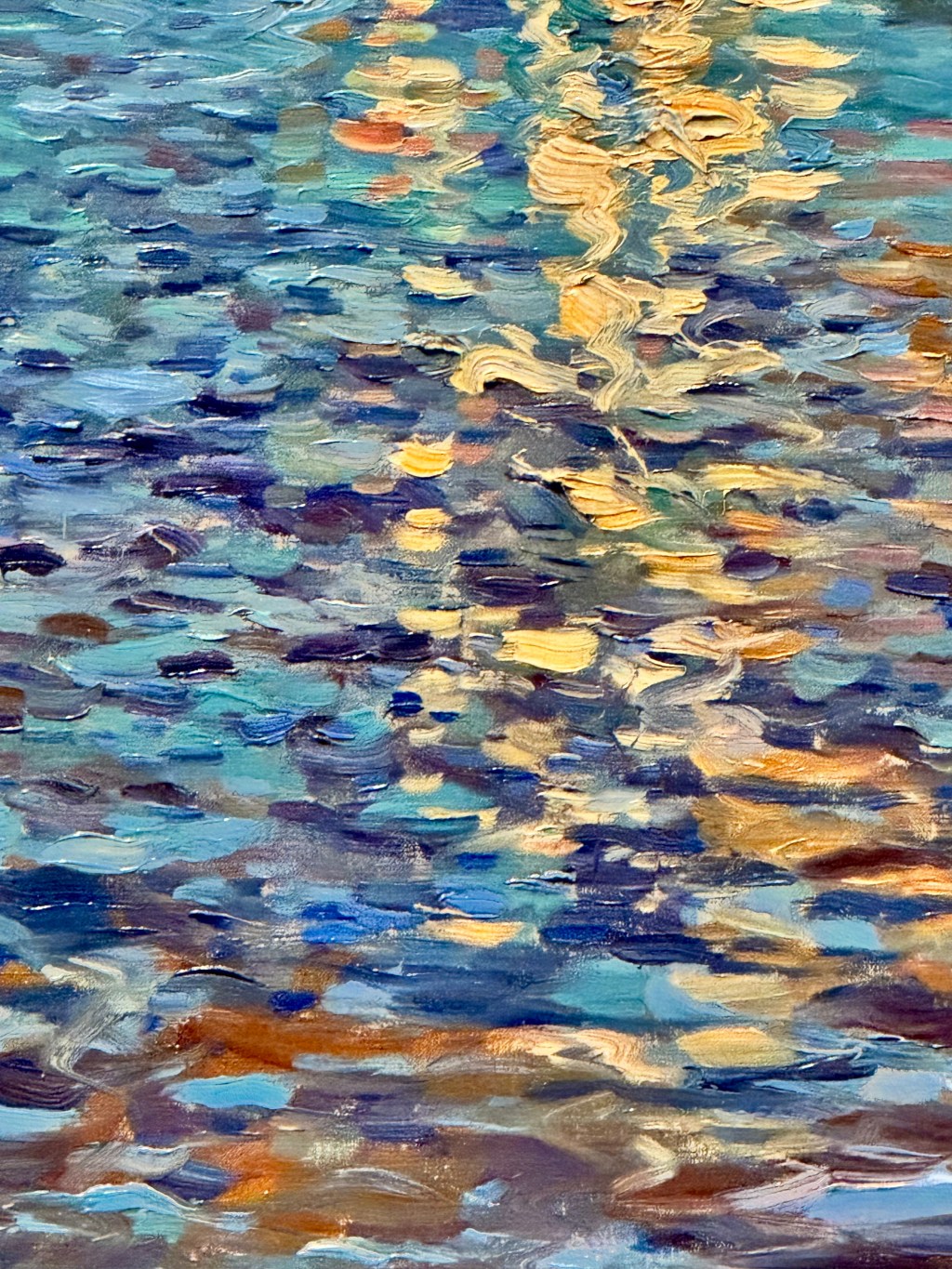



Hinterlasse eine Antwort zu Levion.art Antwort abbrechen